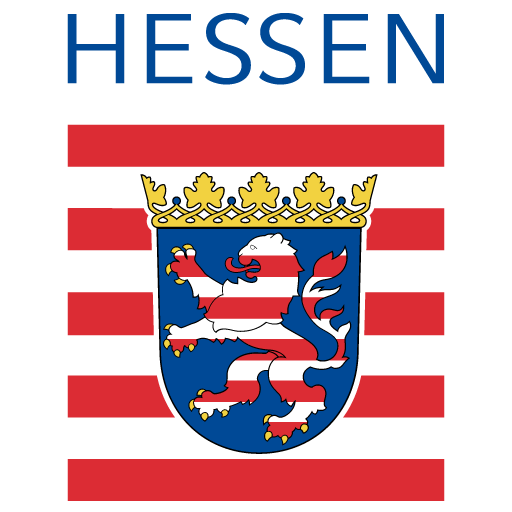Studien und Informationen
Hier finden Sie Links zu relevanten Studien und Publikationen zum dualen Studium.
Aktuelle Informationen und Literaturhinweise zum dualen Studium finden Sie zudem in der AusbildungPlus-Datenbank des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB): https://www.bibb.de/ausbildungplus/de/34714.php
Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) stellt mit dem Fachportal AusbildungPlus ein umfangreiches Informationssystem für duale Studiengänge und Zusatzqualifikationen in der beruflichen Erstausbildung bereit. Das Kernstück des Fachportals ist eine komplexe Datenbank, die fortlaufend aktualisiert wird und deren Datenbestand kontinuierlich wächst.
Ein weiterführender Link zu AusbildungPlus.
Hier zum Download.
Duales Studium liegt im Trend. Gerade das starke Wachstum und die Vielfalt der Studienmodelle machen eine nachhaltige Qualitätssicherung erforderlich. Akkreditierungen und Qualitätskriterien sowie Mindeststandards, wie sie in zahlreichen Bundesländern bereits definiert wurden, sind dabei hilfreich und zielführend: Duale Angebote sind die ideale Antwort auf die Anforderungen der kompetenz- und transferorientierten „Hochschule 4.0". Dieser Beitrag von Prof. Dr. Harald Danne ist erschienen im Fachjournal "Duales Studium", Pilotausgabe, 2019, DUZ Medienhaus, Berlin.
Das Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen hat für die Hans-Böckler-Stiftung eine Studie erstellt, die sich dem dualen Studium widmet. Hierzu wurde ein Methoden-Mix aus quantitativer und qualitativer Datenerhebung gewählt (u.a. wurden zwei bundesweite Online-Befragungen mit 9285 dual Studierenden in 2015 und 2017 durchgeführt und Experteninterviews geführt). Die komplette Publikation (Studie sowie Darstellung betrieblicher Fallbeispiele) finden Sie unter folgenden Links:
https://www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_413.pdf (Studie)
https://www.boeckler.de/de/fau... (Betriebliche Fallberichte)
Als moderne Form der Vermittlung von Theorie und Praxis steht das duale Studium besonderen Anforderungen gegenüber, die sich zum einen aus dem vom Bologna-Prozess geprägten Bildungssystem und zum anderen aus der sich stetig wandelnden, derzeit auf die Digitalisierung von Erwerbsarbeit zustrebenden Arbeitswelt ergeben (vgl. Hirsch-Kreinsen et al. 2015). Ein wesentliches Ziel des dualen Studiums besteht in der Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen am Arbeitsmarkt. Diese lässt sich am ehesten erreichen, wenn die theoretischen und praktischen Studienanteile aufeinander abgestimmt sind, wozu eine Kooperation der verschiedenen Lernorte unabdingbar erscheint. Zumindest in seiner ausbildungsintegrierenden Variante darf sich das duale Studium laut Wissenschaftsrat (2013) sogar nur als solches bezeichnen, wenn eine institutionelle und strukturelle Verzahnung der Ausbildungsinhalte beider Lernorte vorliegt. Diverse deutsche Unternehmen klagen jedoch darüber, dass die akademische und die berufliche Bildung zu wenig vernetzt seien. An diesem Punkt setzt die Untersuchung an und analysiert die Lernortkooperation und damit das Zusammenwirken von Bildungseinrichtungen und den Unternehmen aus der Sicht dual Studierender in den Fächergruppen Ingenieurswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. Mittels Online-Fragebogen wurden Erfahrungen, Einschätzungen und Verbesserungsvorschläge hinsichtlich der Organisation der Ausbildung in den Unternehmen und an den Bildungseinrichtungen, die Qualifizierungsmaßnahmen in den Unternehmen, die Betreuung an beiden Lernorten sowie subjektiv wahrgenommene Belastungen und Autonomiegrade der Arbeit erhoben. Zielsetzung der Studie ist es, Schwierigkeiten der Lernortkooperation aufzuzeigen, diesbezügliches Verbesserungspotenzial zu identifizieren und an theoretisch notwendigen sowie praktisch realisierbaren Anforderungen orientierte Perspektiven für die Weiterentwicklung dualer Studienangebote zu entwerfen, um weiterhin eine hohe Qualität der Lehre an den Hochschulen und Berufsakademien sowie der Ausbildungsanteile in den Unternehmen sicherzustellen. Hier zum Download.
Vorliegend der erste Teil der Empfehlungen zur Qualifizierung von Fachkräften vor dem Hintergrund des demographischen Wandels. Die demographische Entwicklung ist eine der zentralen Herausforderungen, mit denen Deutschland in den kommenden Jahren und Jahrzehnten konfrontiert sein wird. Neben anderen Politikbereichen ist nicht zuletzt die Wissenschaftspolitik gefordert, zur Bewältigung dieser Herausforderung beizutragen. Um trotz des demografischen Wandels die Leistungs- und Innovationsfähigkeit der Gesellschaft zu erhalten und zu stärken, ist ein hohes Qualifikationsniveau sowie ein international attraktives post-schulisches Bildungssystem, das Adaptions- und Innovationsfähigkeiten vermittelt, essentiell. Der vorliegende erste Teil der Empfehlungsreihe des Wirtschaftsrats befasst sich mit dem Verhältnis der beiden post-schulischen Bildungsbereiche. Er beleuchtet ihre Komplementaritäten unf Kooperationspotenziale und diskutiert die erforderlichen Rahmenbedingungen für erfolgreiche sowie individuell flexibel gestaltbare Bildungswege. Hier zum Download.
Innovationen sind die Grundlage für nachhaltige Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland. In innovativen Branchen fehlt allerdings zum Teil bereits heute geeignetes Fachpersonal. Vor allem im sogenannten MINT-Bereich, also in Berufsgruppen, die technischer, mathematischer oder naturwissenschaftlicher Ausrichtung sind, entstehen aufgrund des hohen Ersatz- und des vorraussichtlichen Erweiterungsbedarfs immer größere Lücken. Ein Weg zur nachhaltigen Fachkräftesicherung ist die weitere Stärkung des dualen Studiums. Diese Ausbildungsform bietet vielfältige Vorteile im MINT-Bereich und wirkt sich positiv auf die Anzahl der Studienbewerber aus. Der hohe Praxisanteil des dualen Studiums kommt insbesondere den praxisnahen MINT-Fächern entgegen. Das belegt auch die derzeitige Verteilung dualer Studiengänge auf verschiedene Fächergruppen: so entfallen allein 40 Prozent des Angebots auf Ingenieurswissenschaften und 12 Prozent auf Informatik. Hier zum Download.
Duale Studiengänge sind innovative Angebote an der Schnittstelle von beruflicher und hochschulischer Bildung. Durch ihre unternehmensnahe Ausrichtung und ihre in den letzten Jahren stark gewachsene Bedeutung für die betriebliche Personalentwicklung unterliegen sie ständigen Veränderungsprozessen. Zusätzlich verstärkt wurde diese Tendenz durch die im Rahmen des Bologna-Prozesses erfolgte Umstellung auf Bachelor- und Masterabschlüsse. Somit bestand ein dringender Untersuchungsbedarf bezüglich der sich in den letzten Jahren vollzogenen Modifikationen bei Organisation und Durchführung dieser Studienangebote. Das hier beschriebene Projekt zielt darauf, Erkenntnisse zur akteullen Ausgestaltung dualer Studiengänge an Fachhochschulen zu gewinnen. Zudem werden Empfehlungen zur Modifikation der seit 2003 vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) entwickelten und angwandten Systematik dualer Studiengänge gegeben. Dazu wurden im ersten Teil des Projektes 14 Fallstudien dualer Studiengänge durchgeführt. Im Rahmen der Fallstudien wurden insgesamt 46 Experimentierinterviews mit Vertretern und Vertreterinnen der an den jeweiligen Studiengängen beteiligten Hochschulen und Betrieben geführt und ausgewertet. Begleitend analysierte das Projektteam relevante Dokumente und Online-Publikationen. Im weiteren Projektverlauf wurde eine quantitative Befragung von knapp 1400 an dualen Studiengängen teilnehmenden Betrieben durchgeführt. Hier zum Download.
Mit dualen Studiengängen hat sich ein Erfolg versprechendes Ausbildungsmodell an der Schnittstelle von beruflicher und hochschulischer Bildung etabliert. Das Angebot an Hochschulen und die Nachfrage bei Betrieben und Studierenden ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Es gibt kaum noch ein größeres Unternehmen, welches keine dualen Studienplätze anbietet. Doch aus welchen Gründen engagieren sich Betriebe in dualen Studiengängen und was macht dieses Studienmodell so erfolgreich? Im November 2012 führte das BIBB eine Online-Befragung bei 280 Unternehmen durch, die sich an dualen Studiengängen an Fachhochschulen beteiligen. Die in diesem Beitrag vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass duale Studiengänge attraktive Rekrutierungsinstrumente für die Betriebe darstellen, obwohl ihr qualitatives Potenzial möglicherweise noch nicht ausgeschöpft ist. Hier zum Download.
Auf den Punkt: Ein duales Studium ermöglicht jungen Menschen in der Erstausbildung die Kombination einer beruflichen Ausbildung im dualen Ausbildungssystem mit einer akademischen im Hochschulsystem. Die Zahl der dual Studierenden steigt kontinuierlich an. Zum Stichtag 2011 waren bundesweit 61.195 junge Menschen in einem der 929 dualen Studiengänge eingeschrieben. Dual Studierende sind jung, deutsch, in der Mehrzahl männlich und stammen überwiegend aus Nicht-Akademiker-Haushalten. Das duale Studium ist für Abiturienten eine Alternative zum Regelstudium. Es spricht nicht in erster Linie diejenigen an, die alternativ eine berufliche Ausbildung begonnen hätten. Hoher Praxisbezug, Sicherheit im Studium und beim beruflichen Einstieg sowie bessere Karrierechancen sind entscheidende Motive für ein duales Studium. "Stuzubis" äußern hohe Zufriedenheit mit ihrer Ausbildung in Hochschule und Betrieb. Allerdings führen Abstimmungsprobleme zwischen Lernorten und -inhalten sowie Zeitnot zu Unzufriedenheit. Hier zum Download.